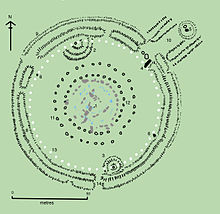Überblick
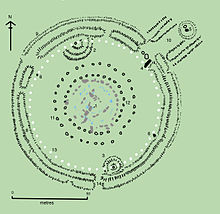
Plan des heutigen Stonehenge.
Der Name Stonehenge stammt aus dem
Altenglischen und bedeutet soviel
wie „hängende Steine“. Der zweite Bestandteil des Namens,
Henge, wird heute als
archäologische Bezeichnung für eine Klasse jungsteinzeitlicher
Bauwerke verwendet, die aus einer kreisförmigen, erhöhten
Einfriedung mit einer innen liegenden Vertiefung bestehen.
Stonehenge selbst ist nach der derzeitigen Terminologie ein so
genanntes atypisches henge, da seine Aufschüttung innerhalb
des Grabens liegt. Es gehört seit 1918 dem englischen Staat.
Verwaltet und touristisch erschlossen wird Stonehenge vom
English Heritage, seine Umgebung
vom
National Trust. Die Stätte und die
Umgebung gehören seit 1986 als Teil der
Stonehenge, Avebury and Associated Sites
zum
Weltkulturerbe.
Der Komplex wurde in mehreren Bauabschnitten
errichtet, die sich über einen Zeitraum von etwa 2000 Jahren
erstrecken. Nachweislich wurde das Gelände aber bereits vor der
Errichtung und auch noch lange Zeit nach der jungsteinzeitlichen
Hochphase genutzt. Drei große Pfostenlöcher befinden sich in der
Nähe des heutigen Parkplatzes, sie datieren aus dem
Mesolithikum, etwa um 8000 v. Chr.
Im Umkreis der Kultstätte wurden in Bodenproben Aschereste von
Feuerbestattungen aus einer Zeitspanne zwischen 3030 und 2340
v. Chr. gefunden, die darauf hindeuten, dass der Ort vor dem
Aufstellen der Steine eine Begräbnisstätte war. Die jüngsten
kultischen Nutzungen sind etwa für das 7. Jahrhundert nach Christus
feststellbar, hier ist ein
Grab eines enthaupteten
Angelsachsen zu erwähnen.
Die verschiedenen Phasen der Aktivitäten in
Stonehenge zu datieren und zu verstehen, ist schwierig, da frühere
Grabungen nicht unseren heutigen Standards entsprachen. Erschwerend
ist zudem, dass es nur wenige
C-Daten gibt. Die heute meist
akzeptierte Abfolge wird im folgenden Text unter Verwendung des
rechts abgebildeten Planes (zu den Ziffern gehörende Legende im
zugehörenden Commons-File) erläutert. Aus Gründen der
Übersichtlichkeit sind die Decksteine dort nicht gezeigt. Heute noch
sichtbare Steine sind als farbige Flecken (blau, braun und schwarz)
dargestellt.
Die Anlage
Der Heel-Stein und die Positionssteine in
Stonehenge sind nach den Positionen der
Sonnenwende und
Tagundnachtgleiche angeordnet. Aus
diesem Grunde wird häufig angenommen, dass Stonehenge ein
vorzeitliches
Observatorium darstellt, obwohl die
genaue Art der Nutzung und seine Bedeutung, wie für Aussaat und
Ernte zu den bestmöglichen Zeiten, noch diskutiert werden.
- Beschreibung der Steine
- Der Altarstein: ein Block von 5
Metern aus grünem
Sandstein. Alle anderen Steine
im inneren Kreis sind
Blausteine (Dolerit), eine
Basaltart aus den
Preseli-Bergen im Südwesten von
Wales, die etwa 380 km entfernt
liegen. Die Sandsteinblöcke des äußeren Kreises müssen auf
Schlitten fortbewegt worden sein, die von schätzungsweise 250
Mann, an Steigungen von bis zu 1000 Mann, gezogen wurden.
Alternativ wird der Einsatz von Zugtieren diskutiert.
- Der Opferstein liegt etwas
abseits vom Zentrum. Der Audioguide, mit dem die Besucher um das
Monument geleitet werden, stellt fest, dass der Stein
wahrscheinlich aufrecht gestanden habe, und dass es sich bei den
roten Flecken auf dem Stein nicht um Blut (das längst verwittert
und abgewaschen wäre), sondern um Eisenoxid-Einschlüsse handelt.
Die Zuordnung "Opferstein" sei deshalb mehr als fraglich.
- Der Heel-Stein (Fersenstein),
auch als Friars Heel bekannt.
- Positionssteine
Weitere Besonderheiten:
- Die Aubrey-Löcher
- Y- und Z-Löcher
Im Auftrag von English Heritage
wurden
Laserscans der Oberflächen aller
noch erhaltenen 83 monumentalen Steine von Stonehenge angefertigt.
Dabei wurden insgesamt 72 bislang unbekannte
Gravuren entdeckt. 71 von ihnen
zeigen Äxte (bis zu 46 cm groß), eine Gravur einen Dolch. Die Anlage
ähnelt den Steinkreisen im Norden
Schottlands, bekannt als der
Ring von Brodgar.
Entstehungsgeschichte
Die vielseitigen Elemente der Anlage wurden
über einen langen Zeitraum in mehreren Phasen errichtet. 1995 wurden
die Ausgrabungen des 20. Jahrhunderts ausgewertet und aufgrund von
14C-Messungen
in drei Phasen datiert. Eine geringfügige Überarbeitung der
Datierung im Jahr 2000 basiert auf der erneuten statistischen
Auswertung der 14C-Daten mittels
Bayesscher Statistik. Bis 2009
kamen weitere kleinere Verschiebungen hinzu.
Ende 2012 legten Mitarbeiter der jüngsten
Datenerhebungen auf Grund eigener Auswertungen eine neue Studie vor,
in der sie ebenfalls mittels Bayes-Klassifikator statt der
bisherigen drei nunmehr fünf Phasen vorschlugen. Eine ähnliche
Interpretation war bereits 1979 gemacht worden, fand jedoch nur
geringe Aufmerksamkeit.
Stonehenge 1
Das erste Bauwerk maß etwa 115 m im
Durchmesser und bestand aus einem kreisförmigen Wall mit einem
Graben als Einfassung, typologisch gesehen also eine atypische
Henge-Anlage. Ein großer Eingang
lag im Nordosten und ein kleinerer im Süden,
Hirsch- und
Ochsenknochen waren am Grund des
Grabens platziert. Diese Knochen waren wesentlich älter als die
Geweihhacken, mit denen der Graben
ausgehoben wurde, und waren gut erhalten, als sie vergraben wurden.
Diese erste Phase wird auf um 3100 v. Chr. datiert. Am äußeren Rand
des so eingefassten Bereiches lag ein Kreis aus 56 Löchern. Diese
Aubrey-Löcher, benannt nach ihrem Entdecker
John Aubrey, einem Historiker des
17. Jahrhunderts, haben einst möglicherweise hölzerne Stützpfeiler
enthalten. Ein kleinerer äußerer
Wall, der den Graben umgab, könnte
ebenfalls aus dieser Periode stammen.
Stonehenge 2
Sichtbare Überreste der zweiten Phase
existieren nicht mehr. Die Datierung erfolgte über „Rillenkeramik“-Fundstücke
(englisch
Grooved Ware),
die in diese Periode (späte
Jungsteinzeit) gehören. Pfostenlöcher weisen darauf hin,
dass im frühen dritten Jahrtausend v. Chr. eine hölzerne Struktur im
Inneren der Einfassung existiert haben muss. Weitere Pfosten standen
am Nordeingang; eine parallele Pfostenstellung lief vom Südeingang
aus ins Innere. Mindestens 25 der Aubrey-Löcher enthielten Überreste
von
Brandbestattungen, die etwa zwei
Jahrhunderte nach der Errichtung dieses Bauwerks angelegt wurden.
Die Löcher wurden also zur Begräbnisstätte umfunktioniert. Dreißig
weitere Feuerbestattungen liegen im Graben und an anderen Punkten
der Anlage, größtenteils in der Osthälfte. Auch unverbrannte Stücke
menschlicher Knochen aus diesem Zeitraum wurden im Graben gefunden.
Stonehenge 3 I
In der Mitte des Heiligtums wurden um das
Jahr 2600 v. Chr. zwei konzentrische Halbkreise aus 80 aufrecht
stehenden Steinen, den so genannten Blausteinen, angelegt.
Diese wurden zwar später versetzt, die Löcher, in denen die Steine
damals verankert waren (die so genannten Q- und R-Löcher), sind
jedoch nachweisbar. Wieder gibt es nur wenige brauchbare
Datierungshinweise für diese Phase. Die Blausteine stammen aus dem
Gebiet der
Preseli-Berge, die etwa 380 km von
Stonehenge entfernt, im heutigen
Pembrokeshire in Wales liegen. Die
Steine sind größtenteils aus
Dolerit, aber mit Einschlüssen von
Rhyolith,
Tuff und vulkanischer und
kalkhaltiger Asche. Sie wiegen etwa vier Tonnen. Der als Altarstein
bekannte sechs Tonnen schwere Stein besteht aus grünem Sandstein. Er
ist zweimal so groß wie die Blausteine und wurde ebenfalls aus Wales
hierher gebracht, vermutlich durch eine
Eiszeit, möglicherweise stand er
als großer
Monolith im Zentrum.
Zu dieser Zeit wurde der Eingang
verbreitert, so dass er nun genau in der Richtung des
Mittsommersonnenaufgangs und des
Sonnenaufgangs zur Wintersonnenwende dieser Zeit lag. Die Blausteine
wurden, wie erwähnt, nach einiger Zeit wieder entfernt und die Q-
und R-Löcher verfüllt.
Möglicherweise wurde auch der Fersenstein
(heel stone) während dieser Periode außerhalb des
nordöstlichen Eingangs aufgestellt. Die Datierung ist aber unsicher,
im Prinzip kommt jeder Teilabschnitt der dritten Phase in Frage. Es
gab vermutlich noch einen zweiten Stein, der aber nicht mehr
existiert. Zwei, möglicherweise auch drei große Portalsteine wurden
innerhalb des nordöstlichen Eingangs aufgestellt. Nur einer davon,
4,9 m lang, ist – umgestürzt – heute noch erhalten.
Ebenfalls der Phase 3 zugerechnet wird der
Aufbau der vier Stationssteine sowie die Anlage der Avenue,
einem beidseitig durch Graben und Erdwall markierten Weg, der über
eine Strecke von 3 km zum Fluss
Avon führt. Bei Untersuchungen
des Weges zeigte sich, dass er in einer durch Schmelzwasser am Ende
der letzten Eiszeit entstandenen Rinne verlief, die manuell nur
geringfügig bearbeitet werden musste.
Irgendwann in der dritten Bauphase wurden
Gräben sowohl um die Stationssteine als auch um den Fersenstein
gezogen, der spätestens dann als einzelner Monolith gestanden haben
muss. Diese Bauphase von Stonehenge ist die, die der
Bogenschütze von Amesbury erblickt
haben dürfte; gegen Ende der Phase scheint Stonehenge die Henge von
Avebury als zentraler Kult-Ort der
Region abzulösen.
Stonehenge 3 II
Am Ende des dritten Jahrtausends vor
Christus, nach Radiokarbondaten etwa zwischen
2440–2100
v. Chr., fand die Haupt-Bautätigkeit statt. Nun wurde die
Konstruktion aus 74 Sarsensteinen (im Plan grau
eingezeichnet) errichtet, die den heutigen Gesamteindruck von
Stonehenge bestimmt. Jeder dieser Steine, die kleineren um 25, die
großen um 50 Tonnen schwer, stammt aus einem 30 km nördlich
gelegenen Steinbruch bei
Marlborough.
30 der Sarsensteine bildeten die Pfeiler
einer kreisförmigen Konstruktion mit einem Durchmesser von dreißig
Metern. Diese Pfeiler trugen einen geschlossenen Ring aus 29
Deck-Steinen. Diese Decksteine waren an ihren Berührungsflächen
durch eine aus dem Stein gehauene
Spundung, sowie an ihren
Auflagepunkten auf den Pfeilern durch eine ebenfalls aus dem Stein
gehauene
Verzapfung gegen Verschiebungen
gesichert. Dass die Sarsensteine einen vollständigen Ring bildeten,
konnte erst 2013 nachgewiesen werden, als eine lang andauernde
Trockenheit durch Unterschiede im Pflanzenwuchs die Verdichtung im
Untergrund auch da aufzeigte, wo die Steine selbst nicht mehr
vorhanden sind.
Innerhalb dieses Kreises wurden fünf so
genannte
Trilithen aufgestellt, je zwei von
einem Deckstein überbrückte Pfeiler. Die hier verwendeten Steine
haben jeweils eine Masse von etwa 50 Tonnen. Auch hier wurden die
Decksteine mit einer Zapfenverbindung auf den Pfeilern gesichert.
Die Oberfläche aller Sarsensteine ist
behauen. Die Flächen wurden geglättet, die Pfeiler der Trilithen
werden nach oben hin etwas breiter, möglicherweise um die
Perspektive des Betrachters
auszugleichen. Die Decksteine der Trilithen erhielten eine leichte
Krümmung und Löcher, sowie
Nut-Feder-Verbindungen, um sie in
die Zapfen der Tragsteine einzupassen und mit den Ecksteinen zu
verkeilen. Auch die Decksteine verjüngen sich von oben nach unten,
die Decksteine des Ringes sind zudem leicht gekrümmt. Zudem finden
sich auf einigen Pfeilern in den Stein gehauene oder geritzte
Abbildungen. Die vielleicht älteste, eine flache rechteckige Form
oben an der Innenseite des vierten Trilithen, könnte eine
symbolische Darstellung einer
Muttergottheit sein. Sie wurde
vermutlich angebracht, als sich der Stein noch auf dem Erdboden
befand. Alle anderen Abbildungen scheinen erst nach dem Aufstellen
der Steine angebracht worden zu sein. Zu nennen sind insbesondere
auf Stein 53 die Abbildung eines Bronzedolches sowie von vierzehn
Axtköpfen, weitere Darstellungen von Axtköpfen finden sich auf den
Steinen 3, 4 und 5. Die Datierung der Abbildungen ist schwierig,
morphologisch bestehen aber Ähnlichkeiten mit spätbronzezeitlichen
Waffen.
Stonehenge 3 III
Zu einem späteren Zeitpunkt der Bronzezeit
scheinen die Blausteine zum ersten Mal wieder aufgerichtet worden zu
sein. Das genaue Erscheinungsbild der Stätte in dieser Periode ist
jedoch noch nicht klar.
Stonehenge 3 IV
In dieser Phase, etwa zwischen 2280 und 1930
v. Chr., wurden die Blausteine erneut umgestellt. Ein Teil wurde als
Kreis zwischen die zwei Sarsensteinanordnungen aufgestellt und die
anderen in eine ovale Form in der Mitte des Monuments eingebaut.
Einige Archäologen nehmen an, dass ein Teil der Blausteine zu dieser
Zeit in einer zweiten Tranche von Wales geholt wurde. Der Altarstein
könnte innerhalb des Ovals verschoben worden sein. Die Arbeiten an
Stonehenge 3 IV wurden im Vergleich mit seinen direkten Vorgängern
eher schlecht ausgeführt. Die wieder aufgestellten Blausteine waren
nur schlecht in den Erdboden eingelassen, einige von ihnen stürzten
bald wieder um.
Stonehenge 3 V
Bald danach wurde der Nordteil des in Phase
3 IV errichteten Blausteinkreises entfernt, und eine hufeisenförmige
Formation entstand, die als Blausteinhufeisen bezeichnet
wird. Dieses spiegelte die Form des zentralen Hufeisens der
Trilithen wider und wird auf 2270 bis 1930 v. Chr. datiert. Die
Phase Stonehenge 3 V verläuft damit parallel zu der von
Seahenge in
Norfolk.
Stonehenge 3 VI
Etwa 1700 v. Chr. wurden zwei weitere Ringe
von Lochgrabungen außerhalb des Steinkreises angelegt. Diese werden
als Y- und Z-Löcher bezeichnet. Die beiden 30 beziehungsweise 29
Löcher umfassenden Kreise wurden jedoch nie mit Steinen besetzt. Das
Monument von Stonehenge scheint dann bald darauf, um 1600 v. Chr.
aufgegeben worden zu sein. Die Löcher füllten sich in den nächsten
Jahrhunderten, die obersten Schichten der Verfüllungen enthalten
Materialien aus der
Eisenzeit.
Ausrichtung
Die Ausrichtung erfolgte so, dass am Morgen
des Mittsommertags, wenn die Sonne im Jahresverlauf am nördlichsten
steht, die Sonne direkt über dem Fersenstein aufging und die
Strahlen der Sonne in gerader Linie ins Innere des Bauwerks,
zwischen die Hufeisenanordnung, eindrangen.
Es ist unwahrscheinlich, dass eine solche
Ausrichtung sich zufällig ergab. Der nördlichste Aufgangspunkt der
Sonne ist direkt abhängig von der
geografischen Breite. Damit die
Ausrichtung korrekt ist, muss sie für Stonehenges geografische
Breite von 51° 11' genau errechnet oder durch Beobachtung ermittelt
worden sein. Diese genaue Ausrichtung muss für den Plan der Anlage
und die Platzierung der Steine in zumindest einigen der Phasen von
Stonehenge grundlegend gewesen sein. Der Fersenstein wird nun als
ein Teil eines Sonnenkorridors gedeutet, der den
Sonnenaufgang einrahmte.
Stonehenge könnte unter anderem dazu benutzt
worden sein, die Sommer- und Wintersonnenwende
und die Frühlings- und Herbst-Tagundnachtgleiche,
und damit die wichtigen jahreszeitlichen Wendepunkte vorauszusagen.
Nach neuesten Forschungsergebnissen scheint
hierbei der Mondlauf eine weitaus größere Rolle gespielt zu haben
als bisher angenommen.
Gerald Hawkins veröffentlichte 1963
einen Artikel in der Zeitschrift
Nature mit dem Titel Stonehenge
Decoded. Nach diesem Artikel könnten die 19 Steine des
Halbkreises in Verbindung mit den 30 Sarsensteinen dazu gedient
haben, den 18,6 Jahre dauernden
Mondfinsterniszyklus zu berechnen.
Die Blausteine
Roger Mercer stellte fest, dass die
Blausteine außergewöhnlich fein
bearbeitet sind. Er stellte die These auf, dass sie von einem bisher
noch nicht näher lokalisierten älteren Monument in Pembrokeshire
hierher gebracht wurden. Die meisten anderen Archäologen stimmen
aber darin überein, dass die Blausteine vergleichbar mit den
Sarsensteinen bearbeitet wurden. Wenn Mercers Theorie korrekt ist,
könnten die Blausteine hierher verbracht worden sein, um ein Bündnis
zu bekräftigen oder Überlegenheit über einen geschlagenen Feind
anzuzeigen. Ovale Aufstellungen von Blausteinen, die der von
Stonehenge 3 IV ähnlich sind, wurden auch bei den als
Bedd Arthur bekannten Stätten in
den Preseli-Bergen und auf der Insel
Skomer vor der Südwestküste von
Pembrokeshire gefunden. Einige Archäologen haben die spekulative
Deutung vorgeschlagen, dass das Eruptivgestein der Blausteine und
die sedimentären Sarsensteine symbolisch für ein Bündnis zwischen
zwei Kulturen aus unterschiedlichen Landschaften und folglich mit
unterschiedlichen Hintergründen sind.
Neue Analysen der zeitgenössischen
Grabstätten in der Nähe, bekannt als die
Boscombe Bowmen, haben gezeigt,
dass zumindest einzelne der Menschen, die zur Zeit von Stonehenge 3
lebten, aus dem heutigen Wales gekommen sein könnten. Eine Analyse
der
Kristallpolarisation hat ergeben,
dass die Steine nur von den
Preseli-Bergen gekommen sein
können.
Aubrey Burl behauptet, dass die
Blausteine nicht allein durch Menschen, sondern zumindest ein Stück
durch die Gletscher des
Pleistozäns von Wales hierher
transportiert wurden. Man fand aber bisher keinen geologischen
Beweis für einen derartigen Transport zwischen den Preseli-Bergen
und dem
Salisbury Plain. Außerdem hat man
keine weiteren Exemplare dieses ungewöhnlichen Doleritsteins in der
Nähe von Stonehenge gefunden.
Techniken der Erbauung und Gestaltung

Tragstein mit Zapfen
Viele Spekulationen gibt es auch darüber,
wie Stonehenge gebaut wurde. Falls die Blausteine von Menschen von
Wales gebracht und nicht von Gletschern hierher transportiert
wurden, wie es Aubrey Burl vermutet, gibt es viele Methoden, die
riesigen Steine mit Seilen und Hölzern zu bewegen.
Im Rahmen eines Experiments wurde im Jahre
2001 versucht, einen größeren Stein entlang des vermuteten Land- und
Seeweges von Wales nach Stonehenge zu transportieren. Zahlreiche
Freiwillige zogen ihn auf einem hölzernen Schlitten über Land und
verluden ihn danach auf den Nachbau eines historischen Bootes.
Dieses versank aber bald mitsamt dem Stein bei rauer See im
Bristolkanal.
Es wurde vermutet, dass A-förmige
Holzrahmen, ähnlich wie bei einer
Dachkonstruktion, benutzt wurden,
um die Steine aufzurichten und mit Seilen in eine senkrechte
Position zu verschieben. Die Decksteine könnten zum Beispiel mit
Holzplattformen angehoben und dann in der Höhe auf ihren Platz
geschoben worden sein. Alternativ könnten sie auch über eine Rampe
nach oben in Position geschoben oder gezogen worden sein. Die
Zapfenverbindungen an den Steinen nach Zimmermannsart legen nahe,
dass die Erbauer bereits über Fertigkeiten der Holzbearbeitung
verfügten. Entsprechende Kenntnisse dürften eine große Hilfe bei der
Konzeption und Errichtung dieses Monuments gewesen sein.
Von
Alexander Thom wurde die Meinung
vertreten, dass die Erbauer von Stonehenge das
megalithische Yard als Basis für
die diversen Längen verwendet haben.
Die auf den Sarsensteinen eingravierten
Darstellungen von Waffen sind in der Megalith-Kunst auf den
britischen Inseln einzigartig. Andernorts wurden abstrakte
Abbildungen bevorzugt. Ähnlich unüblich für diese Kultur ist die
Hufeisenanordnung der Steine, da andernorts die Steine in Kreisen
angeordnet wurden. Das vorgefundene Axtmotiv ist jedoch vergleichbar
mit den Symbolen in der
Bretagne in dieser Zeit. Es ist
somit wahrscheinlich, dass mindestens zwei Bauphasen von Stonehenge
unter maßgeblich kontinentalem Einfluss errichtet wurden. Daraus
würde sich unter anderem die untypische Art des Monuments erklären.
Trotzdem bleibt Stonehenge ein äußerst
ungewöhnliches Monument, auch im größeren Kontext der gesamten
prähistorischen europäischen Kultur.
Es gibt Schätzungen zur menschlichen
Arbeitskraft, die jeweils für die Errichtung der einzelnen Phasen
von Stonehenge notwendig war. Die Summen übersteigen dabei mehrere
Millionen Mannstunden. Stonehenge 1 hat vermutlich etwa 11.000
Stunden Arbeit benötigt, Stonehenge 2 etwa 360.000, und die
verschiedenen Teile von Stonehenge 3 können bis zu 1,75 Millionen
Arbeitsstunden benötigt haben. Die Bearbeitung der Steine setzt man
auf etwa 20 Millionen Arbeitsstunden an, insbesondere in Anbetracht
der in dieser Zeit mäßig leistungsfähigen Werkzeuge. Der allgemeine
Wille zur Errichtung und Pflege dieses Bauwerks muss dementsprechend
ausgesprochen stark gewesen sein und erforderte weiterhin eine stark
ausgeprägte Sozialorganisation. Neben der höchst aufwändigen
Organisation des Bauvorhabens (Planung, Transport, Bearbeitung und
genaue Aufstellung der Steine) verlangt dieses zudem eine hohe
jahrelange Überproduktion von Nahrungsmitteln, um die eigentlichen
„Arbeiter“ während ihrer Tätigkeit für das Vorhaben zu ernähren.
Rezeptions- und Forschungsgeschichte
Erste schriftliche Erwähnungen
Der gesamte Zeitraum von der archäologisch
nachgewiesenen Aufgabe Stonehenges am Ende der Bronzezeit bis zur
Eroberung Englands durch die Normannen liegt im geschichtlichen
Dunkeln. Die erste namentliche Erwähnung liefert
Henry von Huntingdon um das Jahr
1130 in seiner Geschichte Englands; darin zählt er „Stanenges“
in einer kurzen Liste berühmter Denkmäler Englands auf.
Ausführlicher widmet sich
Geoffrey von Monmouth dem
Steinkreis in seiner etwa um 1135 verfassten
Geschichte der Könige Britanniens.
Er schreibt den Bau des Monumentes dem Zauberer
Merlin zu.
Die ersten bildlichen Darstellungen der
Anlage stammen aus Handschriften des 14. und 15. Jahrhunderts. Seit
dem 16. Jahrhundert gibt es verhältnismäßig realistische bildliche
Darstellungen.
Der Historiker
Polydor Vergil (1470–1555) greift
Monmouths Schilderung auf und erklärt Stonehenge ebenfalls als
Denkmal, das der Zauberer Merlin zur Zeit der Eroberung Englands
durch die Angelsachsen mit Hilfe seiner magischen Kräfte errichtet
habe.
Theoriebildung seit der frühen Neuzeit
Um das Jahr 1580 schließt der
Altertumsforscher
William Lambarde erstmals eine
übernatürliche Entstehung der Anlage aus, indem er beobachtet, dass
bei der Errichtung des Steinkreises Zimmermannstechniken auf die
Steinbauweise Stonehenges übertragen wurden. Zudem erkennt er als
erster, dass die Steine nicht wie früher geschildert, von Merlin mit
Hilfe von Zauberei aus Irland herangeschafft wurden, sondern aus der
Region
Marlborough stammen.
Das erste Buch über Stonehenge erscheint im
Jahre 1652. Sein Autor, der Baumeister
Inigo Jones, der die Anlage im
Auftrag des englischen Königs
Jakobs I. ausführlich untersucht
hatte, erklärt den Steinkreis als römischen Tempel zu Ehren des
Gottes
Coelus.
In den folgenden Jahren versuchen sich
verschiedene andere Autoren an der Deutung des Steinkreises: Der
Arzt Walter Charleton nimmt im Jahr 1663 an, Stonehenge sei eine
Krönungsstätte der dänischen Könige Englands gewesen. Der Historiker
Aylett Sammes schreibt im Jahr 1676
den Bau der Anlage den antiken Phöniziern zu.
Der Altertumsforscher
John Aubrey (1626–1697) erkennt am
Ende des 17. Jahrhunderts den Zusammenhang Stonehenges mit
vergleichbaren Monumenten in Schottland und Wales und weist die
Errichtung all dieser Anlagen als Erster richtig einheimischen
Erbauern zu.
Fatal für die zukünftige Forschung und die
Interpretierung der Anlage bis in unsere Zeit erweist sich
allerdings, dass Aubrey Stonehenge und alle ähnlichen Monumente auf
den britischen Inseln den
Kelten zuschrieb. Verständlich wird
sein Irrtum aus der wissenschaftlichen Perspektive Ende des 17.
Jahrhunderts: Es gab keine Möglichkeiten zur Datierung
prähistorischer Bodendenkmäler; man datierte das Alter der Welt noch
nach der biblischen Schöpfungsgeschichte auf wenige tausend Jahre
und die Aubrey bekannte Literatur antiker Schriftsteller enthielt
keine Hinweise auf eine vorkeltische Bevölkerung der britischen
Inseln.
Aubrey konnte den antiken lateinischen und
griechischen Autoren allerdings ausführliche Schilderungen über die
Druiden als keltische
Priesterklasse entnehmen und so vermutete er vorsichtig, die
Steinkreise seien die Tempelanlagen ebendieser Druiden. Tatsächlich
liegen zwischen der Aufgabe der Anlage zum Ende der Bronzezeit und
dem ersten Auftauchen sogenannter keltischer Kulturmerkmale in
Europa mehr als 1.000 Jahre.
Forscher des 18. Jahrhunderts greifen
Aubreys These begeistert auf: Der Historiker
John Toland ordnet Stonehenge in
seiner im Jahr 1719 verfassten Kritische Geschichte der
keltischen Religion und Gelehrsamkeit den Druiden zu.
Der Arzt
William Stukeley führt in den
Jahren 1721 bis 1724 die bis dahin ausführlichsten und präzisesten
Vermessungen der Anlage durch und vermutete als Erster eine axiale
Ausrichtung der Anlage auf den Punkt der Sommersonnenwende. Im Jahr
1740 fasst er seine Ergebnisse in einem Buch zusammen und deutet
Stonehenge allerdings mit fragwürdigen und unwissenschaftlichen
Methoden ebenfalls als druidischen Tempel.
In seinem Buch The Geology of Scripture
(Die Geologie der Heiligen Schrift) deutet
Henry Browne, seit dem Jahr 1824
Kurator von Stonehenge, den
Steinkreis als
vorsintflutlichen Tempel aus der
Zeit
Noahs. Er beruft sich dabei auf die
Theorien des
Paläontologen
William Buckland (1784–1856), der
statt der
Evolutionstheorie die Katastrophen-
oder
Kataklysmentheorie vertritt.
Erste
astronomische Theorien
Den Blick auf eine mögliche astronomische
Nutzung der Anlage eröffnet zu Beginn des 20. Jahrhunderts als
erster der Astronom
Joseph Norman Lockyer (1836–1920).
Er vermutet – wie schon Stuckeley ein Jahrhundert vor ihm – eine
Ausrichtung der Anlage auf den Punkt der Sommersonnenwende,
spekuliert aber weitergehend über die Nutzung des Steinkreises als
astronomischen Kalender zur
Bestimmung heiliger keltischer Feste.
Unter den Archäologen seiner Zeit findet
Lockyers Theorie keine Beachtung, da seine Berechnungsgrundlagen
ungenau und von ihm zum Teil willkürlich ausgewählt wurden, um zu
den von ihm gewünschten Ergebnissen zu gelangen. Stonehenge wird
daher von der archäologischen Fachwelt auch weiterhin „nur“ als
prähistorische Kult- oder Weihestätte betrachtet.
Der Astronom
Gerald Hawkins versuchte dieses
Bild zu ändern, als er im Jahr 1965 sein Buch Stonehenge Decoded
veröffentlicht. Mit Hilfe detaillierter Vermessungen des Monumentes
und komplizierter Berechnungen will Hawkins nachweisen, dass
Stonehenge als eine Art Steinzeitcomputer diente, mit dem es seinen
Erbauern möglich gewesen wäre, zum Beispiel recht zuverlässig
Mondfinsternisse vorauszusagen.
Wie seinerzeit John Aubreys „Keltenthese“
wurde nun auch Hawkins’ Theorie vom breiten Publikum begeistert
aufgegriffen. Die Fachwelt hingegen zerriss seine Forschung: Der
Archäologe Richard Atkinson wies beispielsweise nach, dass Hawkins
in seine Beweisführung auch Teile der Anlage einbezogen hatte, die
nachweislich zu verschiedenen Zeiten bestanden oder errichtet worden
waren und somit nicht Teil derselben Anlage sein konnten.
Ausgrabungen und Forschung
Mit dem Forscher
William Cunnington (1754–1810)
beginnt die neuzeitliche Erforschung Stonehenges. Cunningtons
Ausgrabungen und Beobachtungen
bestätigen die Datierung Stonehenges in die vorrömische Zeit.
Veröffentlicht wurden seine Forschungen in den Jahren 1812 bis 1819
in dem lokalhistorischen Werk Ancient History of Wiltshire
des Historikers
Richard Colt Hoare.
Um 1900 zeigt
John Lubbock auf Basis von in
benachbarten Grabhügeln gefundenen Bronzegegenständen, dass
Stonehenge bereits in der Bronzezeit genutzt wurde.
William Gowland (1842–1922)
restauriert Teile der Anlage und unternimmt die bis dahin
sorgfältigsten Ausgrabungen, die 1901 abgeschlossen werden. Aus
seinen Funden schließt er, dass zumindest Teile des Monumentes zur
Zeit des Überganges von der Jungsteinzeit zur Bronzezeit entstanden.
Der Archäologe
William Hawley gräbt in den Jahren
1919 bis 1926 ungefähr die Hälfte des Geländes aus. Seine Methoden
und Berichte sind allerdings so unzulänglich, dass sich keine neuen
Erkenntnisse ergeben. Dem Geologen H. Thomas gelingt in dieser Zeit
jedoch der Nachweis, dass die Blausteine von den Erbauern der
Anlage aus
Südwales herangeschafft wurden.
1950 beauftragt die
Society of Antiquaries die
Archäologen
Richard Atkinson,
Stuart Piggott und
John Stone mit weiteren
Ausgrabungen. Sie finden viele Feuerstellen und entwickeln die
Einteilung der einzelnen Bauphasen weiter, so wie sie auch heute
noch am häufigsten vertreten wird.
In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts
unternehmen die Archäologen Richard Atkinson und Stuart Piggott
fortwährend weitere Ausgrabungen. Mit der Entwicklung und
Perfektionierung der
Radiokohlenstoffdatierung ab Mitte
des 20. Jahrhunderts gelingen jetzt erstmals sichere Datierungen der
Anlage in die erste Hälfte des 2. Jahrtausends vor Christus.
Atkinson und Piggott restaurieren zudem weitere Teile der Anlage,
indem sie einige der umgestürzten und in Schieflage geratenen Steine
wieder aufrichten und im Boden einbetonieren. Bei diesen
Rekonstruktionen beschränkt man sich bis heute auf solche Steine,
die nachweislich erst in der Neuzeit fielen oder in Schieflage
gerieten oder geraten.
Viele der neuzeitlichen Beschädigungen am
Monument sind einerseits auf den früheren Bedarf der umliegenden
Bevölkerung an Steinen, andererseits auf den Souvenirbedarf früherer
Besucher zurückzuführen. Zwischenzeitlich bot ein Schmied des
nahegelegenen Ortes
Amesbury Touristen einen Hammer zum
Verleih, die sich damit Stückchen von den Steinen als Souvenir
abschlagen konnten.
Im Rahmen des Stonehenge Riverside
Projekts graben Archäologen seit September 2006 in
Durrington Walls 3,2 km von
Stonehenge entfernt die Überreste eines neolithischen Dorfes aus der
Zeit von 2600 bis 2500 vor Christus (Grooved
Ware) aus. „Wir denken, wir haben das Dorf der Erbauer
von Stonehenge gefunden“, äußerte im Januar 2007
Mike Parker Pearson, der Leiter des
Ausgrabungsprojekts von der
University of Leeds.
Vom 31. März bis 11. April 2008 fand die
erste Grabung im Steinkreis seit 1964 statt. Unter der Leitung von
Timothy Darvill und
Geoff Wainwright wurde ein Graben,
der bei den Ausgrabungen von Hawley und Newall in den 1920er Jahren
angelegt wurde, wieder geöffnet, um nach organischem Material zu
suchen. Damit ist es mit Hilfe der
Massenspektrometrie und der
Radiokarbondatierung möglich, den Zeitpunkt, zu dem die Blausteine
aufgerichtet wurden, auf wenige Dekaden genau zu bestimmen.
2010 wurden bemerkenswerte neue Entdeckungen
auf dem Gelände gemacht. Die Anwendung moderner Technologien weist
darauf hin, dass sich in Stonehenge sehr viel mehr findet als nur
der weltberühmte Kreis der steinernen Riesen. Das ganze, viele
Quadratkilometer umfassende Gelände scheint von Kultstätten und
allerlei geheimnisvollen Anlagen völlig durchzogen zu sein.
Britische Forscher wie Vince Gaffney von der
Universität Birmingham sind der
Meinung, man wisse höchstens zu zehn Prozent, was Stonehenge
wirklich war und wie es im Einzelnen aussah. Eine wissenschaftliche
Durchleuchtung des Geländes, die
gerade begonnen hat, ist bereits auf
neue Kreise, Gräben und Hügel sowie
auf sorgsam angelegte Wälle und Vertiefungen gestoßen.
Durch Untersuchungen im Jahr 2013 an der vom
Fluss Avon in Richtung Südwest in die Anlage führenden Avenue
ergab sich, dass hier bereits seit dem Ende der Eiszeit eine
Schmelzwasserrinne verlieft.
Michael Parker Pearson von der
University of Sheffield und Heather
Sebire von
English Heritage nehmen an, dass
die Erbauer von Stonehenge erkannten, dass die Rinne genau in
Richtung der
Wintersonnenwende verläuft. So
erklären sie den Standort der prähistorischen Anlage mit diesem
vorgefundenen Geländemerkmal.[